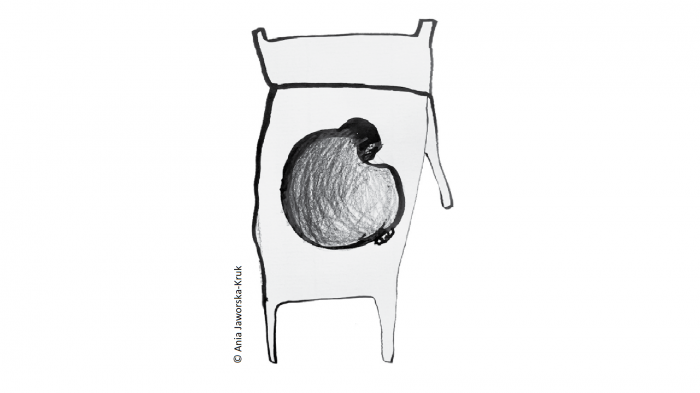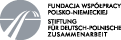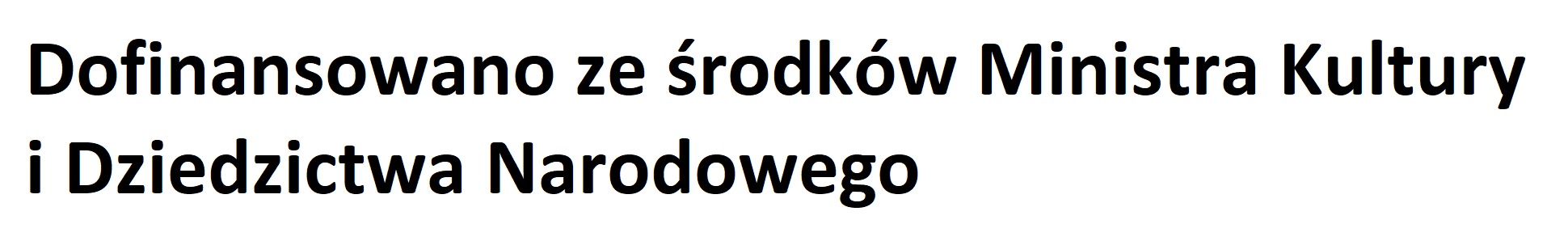Hier ist ein langsames Land. Alles geschieht zu seiner festen Zeit. Die Kirchenglocken läuten am Mittag um fünf vor zwölf und am Abend um fünf vor sechs fünf Minuten lang. Dann schließen die Leute in den Häusern um die wuchtige weiße Kirche die Fenster, damit die Gläser im Schrank nicht klirren.
Jeden Tag im Licht der Dämmerung, zehn Minuten nach Sonnenuntergang, verlassen zwei Waschbären den schon dunklen Wald, schauen rechts und links, ob Autos kommen, überqueren die Straße und gehen zum Abendessen in die Gärten und Garagen.
Die schwarze Katze im ersten Stock öffnet mit der Klinke die Wohnungstür und geht aus dem Haus.
Im Parterre wohnen Neue. Das ist kein Ereignis, weil es niemandem besonders auffällt. Vorher stand die Wohnung leer, jetzt ist sie bewohnt. Nur, dass ein Auto mit fremdem Kennzeichen auf der Straße steht, wird bemerkt.
Montags darf man auf der rechten Straßenseite nicht parken, donnerstags auf der linken nicht. Denn montags wird die rechte und donnerstags die linke Straßenseite geputzt, das bedeutet, irgendwann in den vier Stunden des Parkverbots fährt drei Minuten lang eine Kehrmaschine dicht am Bordstein von einem Ende der Straße zur anderen.
Sinkt die Temperatur im späten Herbst gegen null Grad, kommt der Brunnenmeister und stellt das Wasser der städtischen Brunnen ab. Die Brunnenfiguren aus Sandstein werden zum Schutz vor der Kälte in einen Holzmantel gehüllt.
Immer mal wird ein Markt auf- und irgendwann wieder abgebaut, dazwischen gingen viele Menschen und auch wieder fort.
Auch die zehn neuen Friseursalons, in jedem mindestens drei syrische Friseurmänner mit gezupften Augenbrauen und gelackten steifen Haaren erregen kein Aufsehen. Waren sie nicht schon immer da?
Von den Neuen in der Erdgeschosswohnung weiß man im Vorbeigehen, weil Licht aus der Wohnung scheint, man hörte im Sommer ihre Sprache durch die gekippten Fenster.
Man erkennt die Neuen oft schon von Weitem an ihren blassen Kindern, kleine fahle Geschöpfe. Man würde die Kinder mit Obst und Gemüse versorgen wollen, damit sie nicht so bleich aussehen, aber man sieht sie ja nur im Vorübergehen.
Der Nachbar, der jeden Morgen alle seine Fenster öffnet, sieht die Familie, einen Mann und ein Kind, manchmal eine Frau. Die Frau bewegt sich langsam, sie guckt langsam, sie geht langsam. Der Mann legt auf der Straße den Arm um sie, das Kind nimmt ihre Hand und zieht auch mal die Frau zum Brunnen mit den drei kauernden Marmormännern. Einer spuckte bis vor wenigen Tagen Wasser aus dem Mund, einem schoss es aus den Ohren, der dritte schlürfte es auf. Es ist Trinkwasser, das steht auf einem Schild am Kopf des Wasserspuckers geschrieben. Die Frau ist eingehüllt in Liebe wie die Sandsteinfiguren in Holz und es ist, als arbeiteten die Liebenden den ganzen Tag vergeblich um ihr ein Lächeln zu entlocken. Niemand bemerkt’s bis auf den alten Nachbarn, der neben ihnen alleine wohnt. Er hat ihnen schon alles erzählt, ob sie’s verstanden haben? Dass er zwei Mal verheiratet war und seit 12 Jahren eine Freundin in seinem Alter hat, schon 83 Jahre. Dass es eune gute Beziehung sei, weil sie nicht in einer Wohnung zusammen lebten. Dass er noch kernig sei, keine einzige Tablette.
Und nun, da sie das Laub im Wind sich auf der Straße im Kreis drehen sahen, sang er: Wenn das meine Mutter wüsste, wie´s mir in der Fremde ging! Schuh und Strümpfe sind zerrissen, durch die Hosen pfeift der Wind.
Es wird allmählich Winter.
Durch die Hosen pfeift der Wind, stimmt, oder? sagte er zum Kind. Das Kind stand auf der Eingangstreppe und lachte leise, der Mann lächelte, weil das Kind lachte, aber die Frau schaute nicht einmal hin, nicht so direkt. Der Nachbar sah, dass die Frau nicht den Blick hob, obwohl er sprach, sang und lachte. Dass sie eigentlich wohl die Augen auf hatte, aber nirgends etwas sah, was da um sie war.
Er sei neun Jahre alt gewesen bei der großen Flucht, die kleine Stadt sei nur noch von Geistern und Gespenstern und Katzen bewohnt gewesen, alle Einwohner geflohen. Nur ein Geisterzug habe noch am Bahnhof gestanden, seine Familie habe ja weder Pferd noch Wagen gehabt, die Mutter mit den Kindern hinein in den Zug, in den Rucksäcken Bettdecken, sonst nichts und in der Kälte einfach da sitzen. Und plötzlich, inmitten der Stille, ruckelte der Zug und fuhr los. Die Richtung, das merkten sie erst nach einer Weile, stimmte zum Glück, Richtung Westen, man sei dicht zusammengerückt, habe sich aneinander gewärmt.
Mehr erzählte der Nachbar nicht, denn der Wind pfiff in die Hosenbeine und in die Ärmel und den Kragen hinein. Wer weiß außerdem, wer ihn überhaupt verstand, wer ihn überhaupt hörte. Die Sonne war noch nicht untergegangen, der Mond stand am hellblauen Himmel hoch, der Wind zog die letzten kleinen Blätter von den gestutzten Bäumen.
So standen sie und der steinerne Brunnenkopf spuckte kein Wasser mehr, aber sah immerzu hinab in die Kuhle, es floss dem anderen kein Wasser in den Mund, der Wind wirbelte die hellgelben Blätter herum. Das Kind und der Mann standen höflich vor dem alten fröhlichen Mann, der bei jeder Begegnung etwas erzählte, doch sie verstanden seine Sprache nicht.
Das Kind jedoch lernte jeden Tag die neuen Wörter beim Einkaufen, in der Schule und vom alten Nachbarn.
Bis es schneite und das Kind den Mann im Hausflur traf.
Deine Mutter ist wohl traurig, fragte er das Kind. Und es verstand.
Ja.
Wie heißt du denn?
Maksym.
Willst du auch wissen, wie ich heiße?
Ja.
Soll ich es dir sagen?
Ja.
Ich heiße Walter. Wir konnten niemals mehr nach Hause zurück. In unsere Häuser zogen andere Leute ein, unser Städtchen gehört seither zu einem anderen Land. Ich glaube, sie finden noch unsere Spuren, sie essen noch von unserem Tisch, sie hängen ihre Kleidung auf unsere Bügel, aber ihre Sprache verstehen wir nicht. Aber ihr? Ihr kehrt irgendwann zurück.
Das waren zuviele Worte für das Kind. Maksym verstand nur: niemals mehr zurück.
Er schaute verwirrt den Mann Walter an, blieb aber weiter im Treppenhaus stehen, es war hier wärmer als draußen im Frost. Vom Keller her kroch kalte Luft hinauf.
Und deine Mutter?
Erstaunt schaute Walter auf das Kind, das eine ganze komplette Frage gestellt hatte.
Meine Mutter?
Ja.
Du fragst mich nach meiner Mutter?
Ja.
Willst du was von meiner Mutter wissen?
Ja.
Walter holte Luft, ging in seine Wohnung und kam mit einem rot gepolsterten runden Hocker mit Metallbeinen wieder heraus und stellte ihn vor die hölzerne Tür. Der Hocker seufzte, als der Mann sich setzte und dabei die Luft aus dem Kunststoffpolster entwich. Maksym hatte sich nicht vom Fleck gerührt.
Also meine Mutter. In dem Haus, in das wir zugewiesen wurden, wohnte in jedem Zimmer eine Familie. Wir sind in einem kleinen, schmutzigen, sehr langgezogenen Zimmer gelandet. Auf einer Seite drei Betten an der Wand entlang. Auf der anderen Seite die lange kahle graue Wand.
Mein Vater liebte meine Mutter sehr. Er küsste meine Mutter jeden Tag, wenn er aus dem Haus ging und jedes Mal, wenn er nach Hause kam. All die Jahre. Er brachte etwas mit, Eier, Holz zum Kochen, einen Blumenkohl, manchmal eine Blume.
Maksym war mehr an Walters Mutter interessiert und nicht an all dem anderen, was man so erzählen kann als alter Mann mit einem Leben.
Walter war damals das Kind. Er war mehr mit den anderen Kindern draußen oder bei den Nachbarn im Zimmer und ging nur zum Schlafen nach Hause. Schwermütig nannten die Leute seine Mutter. Sie lag auf dem Bett und wollte nicht mehr aufstehen.
Der Vater sagte: Mein Liebling, mein Schatz, steh doch einmal auf.
Wozu?, fragte die Mutter.
Sie wollte nach Hause in ihr Bett, in ihr Zuhause mit dem tiefen grünen Sofa und dem Ölbild an der Wand, das eine sonnenbestrahlte Waldlichtung zeigte mit Tautropfen auf den Gräsern und hellen leichten Nebelschleiern vor dunklen Tannen. Zu ihrem schlesischen Tafelgeschirr und den Betttüchern ihrer Mädchenzeit, den Tischdecken mit den geklöppelten Schmuckrändern. Zur zierlichen Kommode mit dem ovalen Spiegel. Zu ihrem Küchenschrank mit den vielen schmalen Glasscheiben und den Messinggriffen und dem alten Küchentisch mit der dicken verlebten Eichenholzplatte, auf dem schon ihr Großvater das Brot geschnitten und die Familie Karten gespielt hatte. Sie war aus dem Nest gefallen.
Ihr Mann hatte sie aufgefangen, aber sie war dennoch aus dem Nest gefallen oder gestoßen worden, genauso wie ihr Mann und das Kind dazu. Sie konnten alle nicht fliegen.
Das Nest war für immer verloren, es lebten andere Gestalten in ihrem Bett, auf ihrem Sofa, am Küchentisch und mit ihren Tüchern, Decken, ihrem Geschirr, sogar mit ihrem Kartenspiel. Das Nest war für immer unerreichbar, so wie der ganze Baum und der ganze Wald. Sie konnten zwar nicht fliegen, aber der Mann konnte stehen, die Frau aber nicht. So lag sie nun in einer fremden Stadt in einem häßlichen Zimmer im Bett und war schwermütig, sie sprach kaum mehr. Der Mann küsste sie weiter jeden Tag, er saß auf der Bettkante und streichelte ihr über den Kopf oder den Arm und manchmal verlor er den Mut, stand auf und ging hinaus. Wenn er wiederkam, küsste er sie und hatte etwas mitgebracht, so wie früher; Walter lief ihm jedes Mal entgegen um zu sehen, was.
Der Vater sagte zur Mutter: Wir bauen uns hier unser Leben neu auf. Wir sind zusammen, wir können viel. Sieh mal, die anderen sind allein, überall fehlt jemand, bei uns nicht.
Aber das stimmte nicht, die Großeltern fehlten noch.
Sie blieb liegen und der Mann wusste nicht, wie er sie zum Sprechen und Aufstehen und Lächeln bewegen könnte. Sie lag und vermisste, was war und nie mehr so werden würde, wie es war. Weil es nicht mehr existierte. Nichts mehr, woran man die Zeit messen konnte.
Der Mann sprach von Hoffnung. Bitte schau, bitte sprich, iss, steh auch einmal auf, wir leben doch hier weiter. Wir haben uns. Die Sonne scheint.
Da sagte die Frau gehässig: Sag doch Gott sei Dank, dass du jeden Tag gute Laune hast.
Der Mann wollte am Liebsten vor Wut irgendetwas zerhauen, den Tisch und die Stühle zertrümmern, er sah alles an, aber sie brauchten ja die Stühle, er wollte hinausrennen und die Tür zuschlagen und nie wieder kommen.
Hier scheint die Sonne nicht, sagte die Frau. Das denkst du nur. Bei uns scheint die Sonne und es wird Frühling, das ist ja das Komische.
Der Mann legte sich ans andere Ende der Wand ins Bett und wollte auch nichts mehr. Außer vielleicht noch weiter weggehen, ganz allein. Doch er liebte seine Frau sehr und so blieb er und stand wieder auf. Ihm fiel ein, dass sie auch ein Kind hatten und so ein Kind möchte auch einmal die Eltern sprechen hören und nicht nur nicken sehen. Also sprach er mit dem Kind Walter einiges, ob es verstand, wusste er nicht. Er verstand ja selbst nicht, was er sprach. Aber Walter verstand etwas. Und als der Vater am nächsten Tag nach Hause kam, ging er mit ins Zimmer, wo die schwermütige Mutter im Bett lag und schaute, was der Vater mitgebracht hatte. Es war ein großer Topf mit schwarzer Farbe und ein dicker Pinsel. Damit malte der Vater an die lange Wand zuerst ein Bild mit Tannen und einer Waldlichtung und einem verschnörkelten Rahmen drumherum. Hier ist dein Bild, sagte er. Über dem Sofa.
Und er malte unter den Bilderrahmen das Sofa an die Wand. Dann malte er neben das Bett, in dem die Mutter lag, die Kommode mit dem ovalen Spiegel. Er sagte: Und hier ist die Küche.
Dann malte er den Küchenschrank mit den Glastüren an die Wand, daneben zwei Stühle, davor schob er den Tisch und die drei Stühle, die sie hatten.
So, sagte er. Jetzt sind wir zu Hause. Hier ist das Schlafzimmer, hier das Wohnzimmer, hier die Küche, alles da.
Da bemerkte Walter, wie die Mutter plötzlich aus sich hinaus schaute und die bemalte Wand betrachtete.
So war das, sagte der alte Walter zu dem Jungen Maksym.
Und dann?
Dann ging es allmählich.
Ja?
Ja.
Walter nahm seinen rotgepolsterten Hocker und ging in seine Wohnung. Mir ist kalt, ich muss rein, sagte er, bevor er die Wohnungstür schloss.
Maksym ging nach nebenan, wo er wohnte.
Guck doch aus dem Fenster, sagte er. Aber seine Mutter drehte sich im Bett nicht einmal um. Dem Vater sagte Maksym seinen Wunsch, der wollte erst nicht, aber dann zählte er sein Geld, ging und kam mit kleinen Farbtöpfen zurück. Erst wollte er ihn seinem Sohn geben, dann steckte er selbst den Pinsel zuerst in das rote Farbtöpfchen und begann an die Wand zu malen. Ein Wandteppich entstand, darunter ein Sofa mit Decken.
Als der Vater fertig und die Wand ganz bunt war, mit einem Bild und voll von verlaufener Farbe, drehte die Mutter sich um und schaute.
Was tut ihr da?
Hier, Mama, hier ist unser Wohnzimmer mit dem Teppich und dem Schrank, sagte Maksym. Und hier ist das Schlafzimmer.
Was macht ihr denn überhaupt?, sagte die Mutter. Was soll das?
Und hier ist die Küche mit dem Tisch.
Die Mutter sah missmutig aus, sie setzte sich aber auf und schaute.
Inzwischen malte der Vater neben den Wandteppich einen Baum. Maksym malte Kirschen hinein. Er nahm aus seiner Schultasche die gelbe Wachsmalkreide, stieg auf einen Stuhl und malte eine Sonne an die Wand.
Hast du gesehen? Wenn du hier rausguckst, scheint die Sonne, siehst du? Da ist der Kirschbaum.
Aber der Kirschbaum steht doch nicht im Wohnzimmer, den sehen wir vom Fenster aus, sagte die Mutter.
Da malte der Vater mit dicker brauner Farbe einen Fensterrahmen vor den Kirschenbaum und die Sonne.
So. Jetzt kannst du rausgucken, sagte er.
Die Mutter nickte und blieb sitzen, sie legte sich nicht wieder hin. Alle drei waren still und schauten, warteten, hofften.