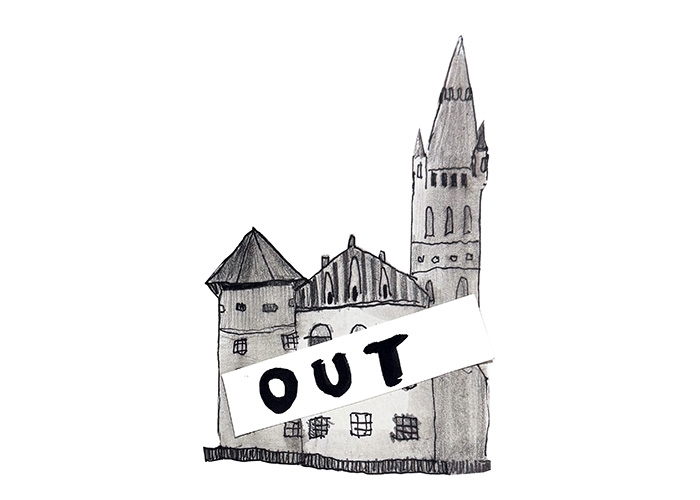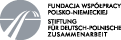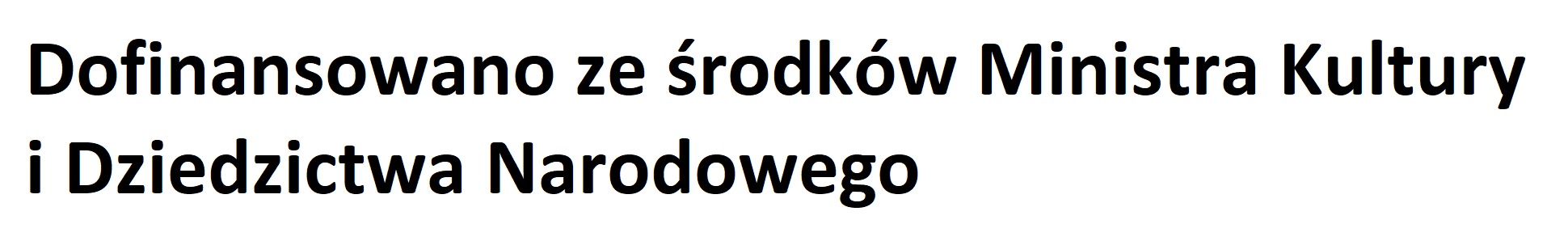Kaliningrad ist eine große Stadt mit fast einer halben Million Einwohnern. Sein Hafen ist einer der größten der früheren Sowjetunion. Es gibt eine Universität, mehr als ein Dutzend Hochschulen und Institute, es hat Theater, Stadien, Museen, mehrere Bahnhöfe und einen Flughafen, eindrucksvolle Parkanlagen. Der Tierpark ist einer der ältesten in Europa. Die Stadt ist stolz auf den »größten Sohn der Stadt«, Immanuel Kant, ihren Botanischen Garten und die Bernsteinindustrie, deren weltweites Zentrum sie ist. Die Straßenbahnen und Busse sind überfüllt, in den leeren Geschäften drängen sich wie überall in sowjetischen Städten die Menschen und vor den wenigen Diskos abends die Jugendlichen der Stadt. Man kann hier mehr ausländische Autos sehen als in Riga oder Sankt Petersburg. Die Seeleute haben sie aus Antwerpen und Hamburg mitgebracht. Die Hauptstadt des Kaliningrader Gebiets, das nach der Auflösung der Sowjetunion zur Exklave geworden und durch Litauen von Rußland getrennt ist, bekommt die Krise des ehemaligen Reiches besonders zu spüren, aus dem einstigen militärischen Sperrgebiet, der »sowjetischen Faust an der Ostsee«, soll eine Freihandelszone werden. Die Stadt, die mehr als vier Jahrzehnte für Fremde geschlossen war, ist jetzt für Fremde geöffnet. Die Einkaufsreisen per Bus über die polnische Grenze sind ausgebucht. Das Tragflächenboot braucht nach Elbing knapp zwei, nach Danzig vier Stunden. Ein deutsch-russisches Konsortium arbeitet in Sonderschichten an der Fertigstellung der Berlinka, wie die alte Autobahnverbindung nach Berlin heute genannt wird. Baltijsk, bisher streng geschlossen, wird demnächstvon Linienschiffen angelaufen werden. Kaliningrad blickt nach Westen und rückt auf den Westen zu. Damit treten die Stadt, die Königsberg war, und das Land, das nördliches Ostpreußen hieß, wieder in den Horizont der Deutschen – ob sie wollen oder nicht.
Die unsichtbare Stadt
Die deutschen Besucher Kaliningrads, die mit dem Flugzeug über Riga, mit dem Zug über Wilna oder nach 13stündiger Fahrt im gecharterten Königsberg-Expreß aus Berlin gekommen sind, sind Reisende besonderer Art. Ihre Augen sehen, was gewöhnliche Reisende mit bloßem Auge nicht erkennen. Sie kennen die Stadt, obwohl sie ihnen gänzlich fremd ist. Ihr Blick zielt auf etwas, was niemand außer ihnen sieht. Sie kennen das Gelände besser als jeder Stadthistoriker. Die Fremden erzählen den Einheimischen, die nur Kaliningrad kennen, von der Stadt, die es gab, bevor es Kaliningrad gab. Die Sicherheit, mit der sich diese Reisenden in der fremden Stadt bewegen, verrät, daß sie sie so gut kennen wie die, die dort leben. Sie steuern Zielpunkte an, die es gibt, obwohl sie nicht mehr existieren. Wo die gewöhnlichen Reisenden nur einer gewöhnlichen Straße folgen, sind sie auf einer Spur. Sie folgen Fährten, auf denen ihnen niemand folgen kann. Ihre Augen kreisen in ständiger Suchbewegung, als ob es nicht doch einen Halt geben könnte inmitten der unendlichen Ansammlung von Plattenbau-Hochhäusern. Sie fixieren ein Gebäude, so als wollten sie vergleichen, ob es das ist, das sie im Kopf haben. Sie schlagen die Augen nieder und gehen resigniert weiter, wenn ihre Erinnerung keinen Anhaltspunkt gefunden hat. Ihre Hände, auf etwas am Horizont weisend, suchen einen Fixpunkt, von dem aus der Raum geordnet, gegliedert werden könnte. Die größten Aufregungen veruracht das Detail, das bei Besuchen in anderen Städten keine Rolle spielt: der gußeiserne Kanaldeckel, der Hydrant mit der Aufschrift »Steinfurt«. Vor dem verbeulten Briefkasten mit deutschen Lettern bleiben sie wie angewurzelt stehen. Sie halten an einer Straßenbiegung an, genau dort, »wo es immer quietschte, wenn die Straßenbahn in die Kurve ging«. Sie deuten mit dem Finger in die Luft, in der nichts zu sehen ist. Aber dort war die Praxis des Zahnarztes oder die Wohnung der Freundin. Ihr Tagesprogramm ist hart, denn sie messen zu Fuß die Straßenzüge ab, in die sich sonst kein Fremder verirrt. Sie legen im hohen Alter noch einmal die Schulwege zurück, die sie als Kinder gegangen sind. Wo andere nichts ausmachen können, deuten sie auf die Pelikanklause. Beim Kaffee, den sie im Hotel Kaliningrad nehmen, ist noch etwas anderes im Spiel: die Abwesenheit des Gesekusplatzes, auf dem heute das Hotel steht. Vom Schlittschuhlaufen auf dem Schloßteich sprechen sie mitten im Sommer. An den Hängen des alten Glacis kommt alten Leuten die Idee, daß man hier ganz gut rodeln könnte. Es ist die Rede von der Elefantendame Jenny und dem Elefantenbullen Hans im Tiergarten, als wären sie noch da. Sie nennen Namen, die keiner mehr kennt: von Alten, die erschlagen, von Kindern, die verschleppt, und von Frauen, die vergewaltigt worden sind. Sie sprechen von Straßenbahnhaltestellen, die es nicht mehr gibt, und verabreden sich an Straßenecken, die längst andere Namen haben. Sie suchen die Friedhöfe auf, die zu Parks geworden sind, und stehen vor der Kirche, die ein Puppentheater ist. Die Brücken werden nicht nach ihrer architektonischen Anmut betrachtet, sondern es war »die letzte Brücke«, über die man entkam, oder »der letzte Zug«, der über sie hinwegfuhr. Die Böschungen an der Samitter Allee sind wie überall auch, aber sie boten einmal lebensrettenden Schutz, oder sie waren zu steil, als daß Entkräftete noch darüber hätten hinwegkommen können. Die schönen Klinkerbauten auf der Klinitscheskaja-Straße stehen nicht für die gute alte Zeit, sondern für das große Sterben der Verwundeten, die in den Kellern übereinanderlagen und wo die einzigen Helden, die es noch gab, Chirurgen waren. Unter dem holprigen Asphalt machen sie Fundamente gesprengter Häuser, in den natürlichen Vertiefungen die Bombentrichter und auf den Spielplätzen die Massengräber aus, in die die Leichen geworfen wurden. Sie kennen die Konditorei mit dem besten Königsberger Marzipan und das Kino, in dem sie noch den »Tiger von Eschnapur« gesehen haben. Die Straße, über die sich der schwarze Menschenknäuel Richtung Pillau, zum rettenden Meer bewegte, wird jetzt vom Taxi aus noch einmal abgefahren. Man irrt sich mitunter, was die Entfernungen angeht; an den Märschen um die Stadt herum, veranstaltet, um die Plünderungen zu erleichtern, nahmen zu Tode Erschöpfte, nicht gewöhnliche Spaziergänger teil. Man ist sich nicht immer sicher, wann die große Synagoge auf der Lomse verschwand – es war 1938, nicht 1944. Die Besucher bewegen sich in einer von Gewalt markierten Topographie. Dort gibt es Orte der Vergeltung und Orte eines »gnädigen Schicksals«, Zonen, in denen die Abstammung, ein Querschläger, die Mordlust, der Alkohol oder der Besitz einer Uhr entschieden, ob man am Leben blieb. Der Himmel über Kaliningrad ist wolkenlos blau, aber in der Erinnerung liegt die Stadt, von der 1947 nur 25 000 Einwohner überlebt hatten, wie versengt und von Verwesungsgeruch erfüllt. Wo jetzt die Menschen spazierengehen, wurden Menschen gejagt. In Kaliningrad regiert das Rechteck der Wohnblocks, im Königsberg im Frühjahr 1945 ragen die Ruinen wie Fischgräten in den Himmel. Das einzig annähernde Bild von der Stadt, wie sie aussah im Untergang, ist ein superrealistisches Modell, das im Bunker unter dem Paradeplatz vor der Universität zu besichtigen ist; es ist aus Pappmaché. Erholung für die Besucher, die müde sind von der Suche nach der Stadt, die es nicht mehr gibt, bietet die Stadt dort, wo sie unversehrt geblieben ist; in den gutbürgerlichen Wohnvierteln von Amalienau, Maraunenhof und Mittel- und Vorderhufen. Wenigstens dort heißen einige Straßen noch, wie sie damals schon hießen: Schiller- und Händelstraße zum Beispiel.
Am Rande des Canyons
Die Besucher Kaliningrads, die aus Königsberg kommen, tragen ein Geheimnis mit sich. Sie wissen etwas, was nur die zu Kriegsende in Ostpreußen Eingeschlossenen wissen können. Sie sitzen abends zusammen an den Tischen in der Bar des zum Hotel umfunktionierten Schiffes Georgi Dimitroff, das auf dem neuen Pregel schräg gegenüber der alten Börse festgemacht hat. Sie kommen vielleicht von einer Fahrt über Land zurück, aus Tilsit, das Sowjetsk, oder aus Insterburg, das Tschernjachowsk heißt. Sie empören sich, daß sie an der Demarkationslinie, die das alte Ostpreußen teilt, von polnischen Grenzbeamten zurückgewiesen wurden und über Litauen einreisen mußten, um von ihrem Heimatort in den Nachbarort zu kommen, der auf der russischen Seite liegt. Sie besprechen, wie sich die Zeiten geändert haben. Noch vor wenigen Jahren war das nördliche Ostpreußen wie ein streng gehüteter Schatz, unzugänglich. Photographieren war soviel wie Spionage, obwohl es doch nur darum ging, ein Bild, das verblichen war, aufzufrischen. Sie haben ihre Stadt verloren, aber wenn sie von ihrem Hotel, ihren Reisen, Autos und ihrem Haus in Deutschland und von den leeren Geschäften Kaliningrads sprechen, wird zweifelhaft, ob nicht aus den Verlierern die Gewinner und aus den Siegern die Unterlegenen geworden sind. Es herrscht unter ihnen eine Vertrautheit, die nicht allein durch die gemeinsame Herkunft aus Königsberg gestiftet sein kann. Was sie eint, ist eher eine einzige entscheidende Erfahrung, ein einziger Augenblick, für den es nur ein Bild in der Erinnerung, kein Wort gibt. Es ist die Vertrautheit der Davongekommenen. Man erinnert vielleicht Einzelheiten – vom Treck, vom Lager Rothenstein, vom Tag im Jahre 1947, an dem der Aufruf zur Abreise kam, vom glücklich erreichten Durchgangslager in Pasewalk und vom Unglück derer, die – nach Pillau entkommen – in der Ostsee versanken. Aber all das sind nur Informationen, die nicht an das heranreichen, was geschehen war. Ein Interview wäre sinnlos. Wenn sie Jüngeren etwas verdeutlichen wollten, würden sie vielleicht hilflos sagen: Es war so wie die Bilder aus Osijek und Goražde. Es kämen Ortsangaben und Begebenheiten zusammen, nicht der entscheidende Augenblick, da alles Zivilisierte vom Menschen abfiel und er zur Kreatur wurde. Den Kreis der Hölle überlebt man – oder nicht. Kein guter Wille von fremder Seite schließt ihn noch einmal auf, er ist nicht einholbar. Dieses schreckliche Privileg teilt die in der »Festung Königsberg« eingeschlossene Zivilbevölkerung mit den Überlebenden von Warschau, teilen die Opfer von Witebsk mit denen von Gumbinnen.
Vielleicht ergeht es den Königsbergern in Kaliningrad wie den Touristen am Rande des Grand Canyon. Alles, was sie am Rande des Grand Canyon stehend sagen, kommt gegen die Leere nicht an. Es bewegt sich der Mund, aber kein Laut ist zu hören. Der ausgestreckte Arm deutet auf etwas in der Ferne, aber es ist nur eine hilflose Bewegung im unendlichen Raum. Über dem Abgrund kreist ein Flugzeug, aber es ist nicht einmal ein Summen zu hören. Wenn sie sich vom Abgrund abwenden und dorthin zurückkehren, wo die Menschen, die Touristen, die Andenkenstände und die Kinder sind, sprechen sie darüber. Aber es ist schon nicht mehr das, was sie gesehen haben.
Der Grundriß
Den Nachgeborenen bleibt die Stadt, wie sie ist, und Texte: die Aufzeichnungen des Festungskommandanten Lash und das »Ostpreußische Tagebuch« Hans Graf von Lehndorffs, die Erinnerungen der Gräfin Dönhoff und des Königsberger Juden Michael Wieck, der Bericht des Chirurgen Wilhelm Starlinger vom Leben und Sterben in Königsberg, die Dokumentationen zu Flucht und Vertreibung. Kaliningrad-Reisende sind in der Regel gut vorbereitet. Es gibt Stadtpläne in verschiedenen Ausgaben. Alt-Königsberger haben die Ergebnisse ihrer ersten Wiederbegegnung nach vierzig Jahren aufgezeichnet und in großformatigen Bildbänden dokumentiert. In Kaliningrad selbst wächst das Interesse an Königsberg. Die Lasch-Aufzeichnungen sind in einer billigen Rotaprint-Ausgabe auf russisch erschienen – mit gotisierenden Schriftzügen –, im Handel ist ein Stadtplan, auf dem die Straßennamen Russisch und Deutsch eingezeichnet sind; erschienen ist eine Geschichte Königsbergs, die wahrheitsgemäß 1945 endet. Alt-Königsberger und Neu-Kaliningrader fahnden gemeinsam nach verschollenen Denkmälern und Bibliotheken; so wirkt das Interesse derer, die ihre Stadt verloren haben, und derer, die – meist selber vertrieben – eine neue Stadt gebaut haben, glücklich zusammen.
Wer die unsichtbare Stadt nicht mehr kennt, hält sich an die sichtbare. Er wandert, ausgerüstet mit den Plänen, die die Stadt davor und danach zeigen, durch die Straßen. Die gegenwärtige Stadt zeigt ihm, was sie von der alten übernommen hat. Das ist verschwindend wenig, aber doch so Elementares, daß klar wird: Kaliningrad ist die Fortsetzung der Stadt mit anderen Mitteln. Die Stadt vor 1945 hatte 700 Jahre Zeit zu wachsen, die Stadt nach 1945 nur knapp 50. Die eine hat im wilden Pruzzenland begonnen, die andere in einem Land, das aus der mitteleuropäischen Hochzivilisation zurückgebombt worden war in die Barbarei.
Die Stadt ist definiert durch ihre Lage. Die Altstadt, der Kneiphof, der Löbenicht liegen plan vor einem in reiner und nackter Form. Beseitigt ist fast alles, was in 700 Jahren sich da angelagert hatte. Es bedurfte dazu nur eines halben Jahres totalen Kriegs. Die Pregelarme und das Gefälle vom Oberteich zum Fluß hin definieren den Ort, der auch durch Überbauung nicht verändert werden kann. Selbst im verschwundenen Königsberg ist der genius loci nicht gestorben, er führte insgeheim Regie. Die Kneiphöfsche Langgasse, die durch die dichtbebaute Dominsel führte, ein Geschäft neben dem anderen, hat einer Hochstraße auf mächtigen Pylonen Platz gemacht. Aber selbst die monströse Hochstraße, die die Pregelarme und die Insel überwölbt, kann den Topos nicht verschwinden machen. Wir müssen immer noch merklich hinaufsteigen zu der Stelle, wo jetzt das Sowjethaus aus Beton und nicht mehr das Königsberger Ordensschloß steht. Die Hochstraße verändert den Maßstab und die Raumverhältnisse. Die Stadt, vor dem Krieg die östlichste deutsche Großstadt, wird durch die neue Maßstäblichkeit noch größer. Die Größe, die vor dem Krieg ausgeglichen war durch die parzellierte und kleinteilige Struktur, durch Abwechslung und Ablenkung, liegt jetzt offen vor einem. Die Straßenzüge sind nicht hineingebrochen in eine enge, verwinkelte Stadt, sondern neu angelegt in einem Gelände, in dem zuvor alle Ruinen niedergelegt worden waren – Geraden in einer Ebene. Und doch folgt das Straßennetz der neuen Stadt der alten mehr, als den Baumeistern der neuen Stadt lieb sein konnte. Die Fluchtpunkte sind geblieben: Wenn man vom Oberteich über den Schloßteich hinabblickt, stößt man auf das Sowjethaus, das, leicht versetzt, an die Stelle des mächtigen Schlosses getreten ist. Die Dominsel ist jetzt, da nichts als die Domruine auf dem leergeräumten Feld zu sehen ist, erst recht zur Dominsel geworden. In einer Stadt, in der die Bastionen und das Glacis der Festungsbauten so prägend geworden sind, treten jetzt, nachdem die alte Stadt, die sie integriert hatte, nicht mehr ist, als ihr eigentlicher Knochenbau hervor. Die Innenstadt, bebaut mit gleichförmigen fünfstöckigen Chruschtoschoby mit gelblichem Anstrich oder Wohnhochhäusern in Plattenbauweise späteren Datums, bekommt paradoxerweise ihre Form und ihren Zusammenhalt durch die alten Stadttore und Bastionen in tiefrotem Klinkerton. Das Brandenburger-, das Friedländer-, das Königs- und andere Stadttore an den Haupt- und Ausfallstraßen Königsbergs sind auch die Eingangspforten in Kaliningrads Innenstadt. Die Hauptlinien der Straßen führen entlang der alten Wälle, und viele von ihnen – wie der Litauer Wall – heißen auch heute noch so. Rest-Königsberg ist nicht das, was nach den alliierten Luftangriffen in der Nacht vom 26. auf den 27. August 1944 und nach der Schlacht um Königsberg geblieben war. Die 40 Jahre Neuaufbau, die auch eine Zerstörung waren, zeigen, daß nicht allein Bombentreffer bestimmten, was bleiben sollte und was nicht. Vom feinen Gewebe der Stadt der Bürger und Kaufleute, von den Geschäfts- und Warenhäusern, Cafés und Buchhandlungen ist nichts geblieben. Übernommen hat man das Elementare, das Gerüst.
Die gußeisernen Kanaldeckel sind so wichtig nicht allein wegen ihrer Aufprägungen »Königsberg i. P.« oder »Steinfurt«, sondern weil sie zeigen, daß selbst die neugebaute Stadt ohne das lebenswichtige Röhrensystem der alten nicht auskam, während man glaubte, auf die Fassaden deutscher Bürgerhäuser verzichten zu müssen. Verwendung fand, was den Geist des »anderen Deutschland« repräsentierte – das Schiller-Denkmal, die Kant-Gedenkstätte –, auch was »neutral« war: die monumentalen Speicheranlagen am Hafen, die Gasanstalt, die Schichau-Werft, die Fabrikanlagen von Waggonbau Steinfurt. Man hat einige der kostbarsten Kirchen abgerissen – aber auch hier sind bewundernswerte geblieben: die Luisenkirche, die katholische Kirche, die Rosenauer Kirche –, aber nicht die Kathedralen des 19. und 20. Jahrhunderts. So ist der monumentale Königsberger Hauptbahnhof erhalten und durch den weiten Vorplatz mit der Kalininstatue noch monumentaler geworden. Die Klinkerbauten am Hinterroßgarten und die Psychiatrie in der Alten Pillauer Landstraße sind nicht der preußischen Architektur zuliebe erhalten, sondern weil es sich um leistungsfähige und seinerzeit modernste Krankenhausbauten handelte, die man übernehmen mußte. Der Unschuld des Vergnügens, die ein Zoo-Besuch eben ist, verdankt sich wohl, daß die Eingangspforte erhalten blieb. Das kompletteste Ensemble findet sich dort, wo die Herrschaft übernehmen konnte, was sich die Herrschaft gebaut hatte, noch dazu in einem Stil, der dem eigenen verwandt war. Die Titel der Gebäude ändern sich, die Herrschaft bleibt. Umstellt ist der Hansa-Platz des Sieges, von dem monumentalen grauen Gebäude des Nordbahnhofs (Haus der Seeleute), dem Amts- und Landgericht, dem Polizeipräsidium und dem Stadthaus. Die Vorortzüge nach Rauschen und Cranz an der Ostsee gehen nach wie vor von diesem Platz ab. Dort wo einmal der Eingang zur »Deutschen Ostmesse« war, steht jetzt eine Lenin-Statue mit dem Rücken zum Park, in dem hinter Bäumen versteckt das Tragheimer Pfarrheim liegt. Aber selbst der ruinierte Messeplatz erfüllt einen Teil der Funktionen, die ihm zugedacht waren. Am alten Wallring, in den Überresten der Deutschen Ostmesse und in dem von Ebert eingeweihten Haus der Technik macht sich der Markt breit. Gehandelt werden Melonen, DM, Gold, Trödel. Und die wenigen in der Stadt verstreuten Skulpturen – die kämpfenden Wisente vor dem Amtsgericht (für alte Königsberger: Staatsanwalt und Rechtsanwalt) oder der aus Tilsit stammende Elch im Tierpark – verdanken ihre Existenz wohl dem Umstand, daß sie ganz unideologisch »reine Natur« darstellen. Es blieben die Straßennamen, die unverdächtig waren: die Namen im Komponistenviertel, die Richard-Wagner-Straße, der Litauer Wall. Andere Namen aus der preußischen Geschichte waren sinn- und bedeutungslos geworden. An die Stelle Wrangels ist Tschernjachowski und an die Stelle Hindenburgs Bagration getreten. Amalienau, Hufen und Maraunenhof mit ihren ansehnlichen Villen und Wohnhäusern sind erhalten, nur der Farbton hat sich ins Grelle – Blau, Grün, Rot – russischer Städte geändert. Von der Synagoge an der Honigbrücke ist nichts erhalten, wohl aber das Gebäude des jüdischen Waisenhauses daneben. Das 1924 im Stil der neuen Sachlichkeit errichtete Kantgrab mit den hohen Pfeilern, ursprünglich sich anlehnend an die Südseite des Chors des Domes, hat das Bombardement nahezu unbeschädigt überstanden, während der Dom in Asche gefallen ist. Nun scheint sich die Domruine ans Kantgrab anzulehnen. So hat der tote Philosoph, der gegen den Wahn nichts ausrichten konnte, wenigstens die Ruine gerettet.
Stadt ohne Hannah Arendt
Mit dem horror vacui fertig zu werden, ist für alle Königsberg-Besucher, die die Stadt kannten, wie sie »davor« war, wie für die, die sich nur aus Texten und Bildern eine Vorstellung machen können, das größte Problem. Man kann die Leere auffüllen mit geschichtlichem Material und mit der Imagination von Bildsequenzen: Gründung durch den Deutschen Orden und den böhmischen König Ottokar II. im Jahre 1255, Königsberg als Zentrum des Humanismus und der Reformation unter Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Gründung der Universität 1544, Königsberg im Goldenen Zeitalter Immanuel Kants, der hugenottischen und Salzburger Flüchtlinge. Wir stellen uns die verschwundenen Bibliotheken vor: die Wallenrodtsche im Südturm des Doms, die des Fürsten Radziwill, die Königliche Bibliothek. Wir bringen alle zusammen, die hier gelebt und gearbeitet haben: von Kristionas Donelaitis bis Käthe Kollwitz, von E.T.A. Hoffmann bis Thomas Mann, der in der Nähe sein Sommerhaus am Meer hatte. Wir stellen uns die Wucht der Kriegsmaschine vor. Doch es bleibt ein letzter, nicht auflösbarer Rest. Wer die Bilder von der Stadt, die nach dem alliierten Luftangriff im August 1944 in Trümmer gesunken war, sich angesehen hat, hat immer noch eine Stadt, eine Stadt in Ruinen, vor sich. Sie ist noch da, als zerstörte. Kaliningrad ist aber das, was kommt, wenn das andere verschwunden ist, eine Stadt, errichtet auf einem Plateau, das leergefegt ist. Wir möchten Zuflucht nehmen zur Dialektik, die uns über die tabula rasa hinweghilft. Aber sie ist hier nur ein Trick. Königsberg/Kaliningrad liegt im Planquadrat des totalen Krieges. Es ist das Ende und die Wiederbegründung menschlicher Wohnstätte auf verbrannter Stelle. Die monotone Stadt ist die Stadt nach dem Grauen. Es ist die Stadt der doppelt Vertriebenen: derer, die ihre Stadt verloren haben, und derer, die dort eine neue gebaut haben, nachdem Minsk, Gomel, Witebsk dem Erdboden gleichgemacht worden waren. Als Kant über seine Heimatstadt, die er niemals verließ, einmal bemerkte: »… eine solche Stadt, wie etwa Königsberg am Pregelflusse, kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung der Menschenkenntnis als auch der Weltkenntnis genommen werden; wo diese, auch ohne zu reisen, erworben werden kann«, da war dies zugleich eine Selbstbeschreibung des Ortes der Aufklärung: »die Lage zum Seehandel«, die Verbindung zu »entlegenen Ländern von verschiedenen Sprachen und Sitten«, die weltoffene europäische Stadt.
Das Geheimnis Königsbergs/Kaliningrads bringt nicht Kant, der Philosoph des 18. Jahrhunderts, zur Sprache, sondern Hannah Arendt, eine Frau des 20. Sie kam gut 200 Jahre später – 1906 – zur Welt, noch hineingeboren ins »Zeitalter der Sicherheit« und bald hineingerissen in das heillose Jahrhundert. Sie sieht die Dämmerung des Lichts, das Kant erst heraufkommen sah. Für sie, die Enkelin von aus dem Russischen Reich nach Preußen eingewanderter Juden, gibt es weder in Königsberg noch in Kaliningrad ein Denkmal. Der Platz, an dem ihr Elternhaus gestanden hatte, Tiergartenstraße 6 – heute ebenfalls: Zoologitscheskaja –, unweit des gut erhaltenen Gymnasiums an der Ecke zur Hufenallee, ist leer, möglicherweise der Erweiterung des Tiergartens zum Opfer gefallen. Vielleicht mußte man aus einem exzentrischen Landstrich des Deutschen Reiches kommen, aufgewachsen in einer reichen bürgerlichen Stadt, mit Wurzeln in den östlich gelegenen Raum hinein, um aus der Krise der bürgerlichen Welt auf die Zerstörungspotentiale schließen zu können, die freigesetzt werden, wenn die bürgerlichen Klassenverhältnisse und die europäische Staatenwelt erst einmal zusammengebrochen sind. »Die erste Explosion«, schreibt Hannah Arendt über den 1. August 1914, »war wie der Starter einer Kettenreaktion, die bis heute nicht zum Halten gebracht werden konnte … Nichts, was seit dem Ersten Weltkrieg sich wirklich ereignete, konnte wieder repariert werden, und kein Unheil, nicht einmal der Ausbruch eines zweiten Weltkrieges, konnte verhindert werden. Jedes Ereignis hatte die Qualität einer Katastrophe, und jede Katastrophe war endgültig.» Königsberg lag irgendwo im Epizentrum dieser von Hannah Arendt beschriebenen Katastrophen des totalitären Zeitalters, in dem die Besitzverhältnisse zerbrachen, Bürgerkriege tobten, Millionen umgebracht und Millionen zu Staaten- und Heimatlosen wurden. Königsberg erlebte die Deportationen nach Theresienstadt und die nach Workuta; die Stadt erlag dem Mob Erich Kochs, des Gauleiters in Ostpreußen, und sie war dem Wüten einer Armee ausgeliefert, die Hitler schlug; sie hörte in der altehrwürdigen Albertina zuerst die rassebewußten Vorlesungen eines Konrad Lorenz, dann die vom Sieg des Klassenbewußtseins. Königsberg, noch Anfang 1945 fast eine Insel innerhalb der europäische Erfahrung des Heimatlosgewordenseins, die der Flüchtling Hannah Arendt so eindringlich formuliert hatte, war damit definitiv auch zu einer deutschen geworden.
Mit Königsberg ging weit mehr verloren als eine schöne Stadt in einem wunderbaren Land, die Grenze, die dort besichtigt werden kann, ist nicht bloß ein völkerrechtlicher Tatbestand, sondern verläuft entlang einer historischen und zivilisatorischen Bruchstelle. Die Begegnung mit Königsberg/Kaliningrad ist die Begegnung, die den endgültigen Abschied, und der Abschied, der den Anfang nach einem Ende möglich macht. Es ist der zugespitzte Punkt, an dem sich erweist, ob eine Nation mit ihrer Geschichte, mit sich selbst ins reine gekommen ist und die Kraft besitzt, aus der Anerkennung des Verlustes etwas zu machen. In Kaliningrad wartet man wie überall sonst im östlichen Europa auf europäisches, auf deutsches Engagement, auf eine Bewegung des go east, nicht bloß auf einen aus Trauer und Anhänglichkeit gespeisten Tourismus.
Aber in Deutschland ist man auf den Neuanfang nach dem Ende der Weltkriegsepoche nicht vorbereitet: noch im unverhofft glücklichen Augenblick der Wiedervereinigung spielt man mit der polnischen Grenze, und gegen den deutsch-tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrag, der den Weg in das Europa nach dem Krieg ebnen soll, werden Eigentumsansprüche aus der Zeit vor dem großen Krieg geltend gemacht. Armes Deutschland!
Nicht anders ist es mit Königsberg/Kaliningrad. Die fortschrittliche Öffentlichkeit beharrt auf ihrem Vorurteil, daß das Trauma von Vertreibung und unersetzlichem Verlust allein Sache der Vertriebenen sei – eine Grunderfahrung der Deutschen in diesem Jahrhundert der Flüchtlinge wird damit zu einem Exotikum, das man nicht weiter ernst nehmen muß. Die Vertriebenenfunktionäre sind an der Verwaltung des Traumas, nicht an dessen Auflösung interessiert – es ist ihr Beruf, sie beziehen daraus ihre Revenue. Beides ist obsolet. Für das Denken, das blockiert ist, und für die Mittel, die in alt gewordene Apparate fließen, gibt es längst neue Tätigkeitsfelder, auf denen es sich zu arbeiten lohnte: Königsberg/Kaliningrad zum Beispiel.
(1992)
Die Redaktion von RADAR dankt dem Autor, als auch Piotr Kłoczowski - Herausgeber der Mnemosyne-Bibliothek und dem Verlag Słowo/obraz terytoria für die freundliche Genehmigung zum Nachdruck des Textes.