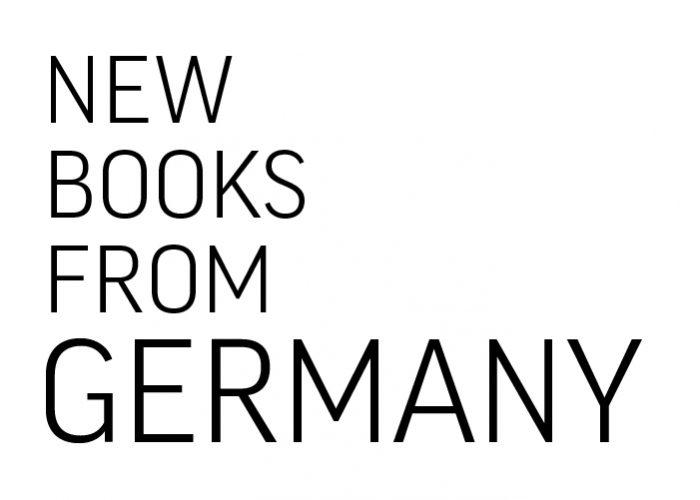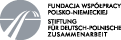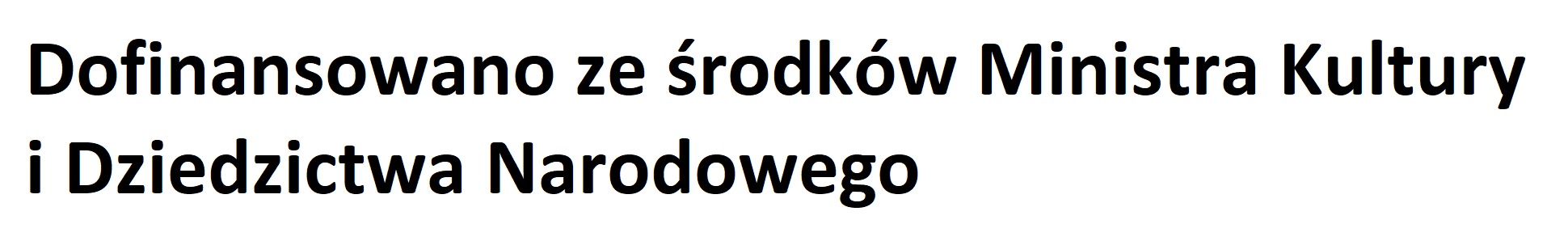Tommie Goerz, Im Schnee, Piper Verlag, München 2025.
Ein Dorfroman. Keiner, der die Dinge nostalgisch verklärt. Ein Buch, das den gegenwärtigen Zustand genau einfängt und in Rückblicken zeigt, was das Dorfleben einmal ausgemacht hat.
Das Panorama, mit dem Im Schnee eröffnet, ist beinahe ein Gemälde. Der alte Max steht am Fenster seines kleinen Hauses und blickt nach draußen auf die Apfelbäume. Es hat zu schneien begonnen, und Max blickt in die friedliche, sanfte, gedimmte Welt. Gestorben ist der alte Schorsch. Der alte Schorsch war Max‘ bester Freund, schon seit Kindheitstagen, und auch noch ein bisschen mehr als nur der beste Freund. Der Max hat nie geheiratet. Mehr braucht ein dezenter Autor nicht zu sagen; mehr müssen wir als Leser auch nicht unbedingt wissen.
Tommie Goerz schreibt schnörkellose, unsentimentale, klare Sätze und entfaltet darin auf noch nicht einmal 200 Seiten das anschauliche Panorama eines Soziotops – und das Porträt eines bemerkenswerten Mannes, der nicht weiß, dass er bemerkenswert ist, weil er wenig mehr kennt als das Leben, das er hatte; als die Landschaft, die ihn eingeschlossen hat. Er hat sein Wissen und seine Erinnerungen. Das genügt für einen wirklich wunderbaren Roman.
Auszug aus einer Buchbesprechung von Christoph Schröder.
Auszug aus dem Buch im Original und in der Übersetzung ins Polnische von Artur Kożuch finden Sie auf der Website des Goethe-Instituts: https://www.litrix.de/de/ buecher.cfm?publicationId=3875
Martin Scherer, Takt. Über Nähe und Distanz im menschlichen Umgang, zu Klampen! Verlag 2024.
Unaufrichtigkeit, Heuchelei, gar Verlogenheit – das alles sind Zuschreibungen, gegen die ritualisierte Formen der Höflichkeit sich behaupten müssen. So grenzt es also heute fast schon an Snobismus, eine engagierte Abhandlung über den „Takt“ im Leben zu schreiben.
Der Philosoph Martin Scherer hat es jetzt getan und in sechs eleganten Kapiteln eine Verteidigung diverser Verhaltenslehren höflicher Distanznahme verfasst, die das gesellschaftliche Miteinander regulieren. Hintergrund dieser Verteidigung ist dabei immer unsere Gegenwart. So liest sich Scherers historische Betrachtung des Taktgefühls auch immer als Gegenentwurf zu identitären Positionen einerseits und identitätspolitischen Positionen andererseits, die manchmal zwar den Esprit der Revolte verströmen können, allzu oft aber auch nur eine Spielart narzisstischer Selbstinszenierungen sind, die Menschen trennt und nicht vereint. Identitätspolitik bedrängt, so könnte man aus Perspektive des Takt-Theoretikers sagen, die Gesellschaft mit individuellen Befindlichkeiten, anstatt universalistisch am Gelingen eines heterogenen Gemeinwesens zu arbeiten.
Höflichkeit, Taktgefühl, Diskretion oder sogar höhere Verstellungskunst sind Werkzeuge gegen die Barbarei des Gefühlsausbruchs. Komplimente sind in dieser Logik, selbst wenn es sich um taktische Lügen handelt, „Etüden des Wohlwollens“. Es klingt fast zu simpel, aber genau daran scheint es der verunsicherten Gesellschaft heute zu mangeln. Zerrieben zwischen Seelenporno, Hassrede und salonfähiger Egomanie auch in den Reihen demokratischer Tugendwächter, droht der öffentliche Diskurs nicht nur zu verrohen, sondern auch der Welt ihren letzten Zauber zu nehmen.
Auszug aus einer Buchbesprechung von Katharina Teutsch.
Auszug aus dem Buch im Original und in der 212 Übersetzung ins Polnische von Mark Ordon finden Sie auf der Website des Goethe-Instituts: https://www.litrix. de/de/buecher.cfm?publicationId=3870
Kathrin Bach, Lebensversicherung, Voland & Quist Verlag, Dresden und Berlin 2025.
Kathrin Bachs schmissiger Text spielt zwischen öffentlichem, wohlgeordnetem Raum und eher chaotischem Familienleben. Er ist weniger ein Roman, sondern wirkt wie das Gesprächsprotokoll einer Therapiesitzung – zu der die Ich-Erzählerin während ihrer Studienzeit auch gehen wird, um ihre zahlreichen Phobien zu behandeln. „Ich habe Angst davor, woanders als zu Hause oder bei Oma F oder Oma G zu Mittag zu essen. Ich habe Angst davor, bei einer Freundin etwas essen zu müssen. Davor, dass mir das von der Mutter der Freundin Zubereitete nicht so schmeckt wie das von meiner Mutter. Davor, keinen oder nicht genug Appetit zu haben. Vor dem Völlegefühl danach. Völlegefühl ist schlimm. Aber noch schlimmer ist die Übelkeit.“
Nach Art eines Flickenteppichs collagiert dieses Buch Kindheitserinnerungen, Familienchronologien, Fachund Sachtexte der Versicherungswirtschaft und Gesprächsprotokolle. Dieser Collageroman ist vieles zugleich: Gesellschaftsstudie, Gedankenbühne, Psychoanalyse, Slapstick und Memento Mori.
Nach der Lektüre dieses lakonischen Debüts fühlt man sich zwangsläufig unterversichert – aber grandios unterhalten von Kathrin Bach und ihrer Ich-Erzählerin, die am Schluss zwar immer noch Angst hat, weil sie weiß, dass jeder jederzeit gehen kann, weil sie weiß, dass jedes Auto zercrashen kann. Doch zeigt ihre Verhaltenstherapie eine immanente Wirkung. Kathrin Bachs Lebensversicherung schließt hingegen tröstlich in der Erkenntnis, dass zwar alles stirbt: „wir vorher aber auch ein bisschen leben“ – und lesen dürfen.
Auszug aus einer Buchbesprechung von Jan Drees.
Auszug aus dem Buch im Original und in der Übersetzung ins Polnische von Ewa Mikulska-Frindo finden Sie auf der Website des Goethe-Instituts: https://www.litrix. de/de/buecher.cfm?publicationId=3872
Ulrike Edschmid, Die letzte Patientin, Suhrkamp Verlag, Berlin 2024.
Man hat bei Ulrike Edschmids Büchern immer den Eindruck, sehr viel Stoff gelesen zu haben, dabei sind ihre Bücher unter 200 Seiten lang. Das liegt daran, dass Edschmid mit Leerstellen arbeitet, so dass sich dramaturgische Spalten und Brüche auftun. Zwischen den Zeilen, die es in ihre Bücher schaffen, steckt viel Lebenszeit – und beim Lesen füllt man die Lücken automatisch auf und hat so den Eindruck, umfängliche Bücher gelesen zu haben.
Die letzte Patientin ist ein intensives und bewegendes Buch, das in dichter, klarer Prosa geschrieben wurde. Ulrike Edschmid umkreist wichtige Fragen: Was bleibt von einer Biographie, wer hält die eindrücklichsten Geschichten fest, wenn man es selbst nicht tut? Was ist ein gelungenes Leben, was ist Familie? Wie nah kann man anderen kommen? Und wie findet man eine Sprache für ein Trauma? Ein schmales, gewichtiges Buch, das lange nachhallt.
Auszug aus einer Buchbesprechung von Anne-Dore Krohn.
Auszug aus dem Buch im Original und in der Übersetzung ins Polnische von Zofia Sucharska finden Sie auf der Website des Goethe-Instituts: https://www.litrix.de/de/ buecher.cfm?publicationId=3849
Christine Wunnicke, Wachs, Berenberg Verlag, Berlin 2025.
Christine Wunnicke schreibt über Menschen mit besonderen Begabungen. Und zwar so, dass das Unzeitgemäße an ihnen ein Tänzchen mit dem Weitsichtigen aufführt. Fasziniert folgen wir dem Personal der Münchner Autorin, die bald zu ihrer eigenen Romanfigur werden könnte. Die Liste der Lebenswelten, für die Wunnicke brennt, ist sehr lang. Aber immer sind es Einzelgänger, besessen von einer Idee, getrieben von einem in die Tiefen der menschlichen Seele hineinreichenden Erkenntnisdrang, mit dem die Autorin wiederum ihr Publikum zu interessieren weiß.
Wachs handelt von der berühmten, aber heute nur noch Kennern geläufigen Pariserin Marie Bihéron, die im Paris des achtzehnten Jahrhunderts lebte und deren Lebensziel es gewesen war, „der beste Anatom von Paris“ zu werden. Dieser neue Roman von Christine Wunnicke ist eine Zeit- und Ideenreise in ferne Gebiete. Das meiste daran stimmt, das Wichtigste: nämlich der Ideenkosmos und das seelische Drama, das ihm zugeordnet werden muss. Der Rest ist kongenial erfunden.
Man lernt ungeheuer viel in diesem kleinen Roman, man lacht aber auch viel über die Skurrilitäten der beiden Romanheldinnen. Ihr Denken und Handeln erscheint uns aus heutiger Perspektive zugleich im Stoff historisch und in seiner Radikalität zeitlos. Aus dieser Aktualität des zu 214 allen Zeiten konstanten menschlichen Erkenntnisdrangs blühen alle Romane von Christine Wunnicke. So hat auch Wachs einen Sog, dem man sich gerne aussetzt. In einer einzigartigen Mischung aus Slapstick, Ideenarchäologie und Seelendrama bringt „Wachs“ uns den Menschen des Aufklärungszeitalters nahe.
Auszug aus einer Buchbesprechung von Katharina Teutsch.
Auszug aus dem Buch im Original und in der Übersetzung ins Polnische von Katarzyna Łakomik finden Sie auf der Website des Goethe-Instituts: https://www.litrix.de/ de/buecher.cfm?publicationId=3884